Wie zuletzt die hitzige Debatte um die Übersetzung des Inaugurations-Gedichts „The hill we climb“ von Amanda Gorman gezeigt hat, wird das Thema Rassismus auch im deutschen Literaturbetrieb vermehrt diskutiert. Zudem sind in den letzten Jahren mehrere Texte erschienen, die sich literarisch mit rassistischen Erfahrungen und der komplexen Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit Schwarzer Menschen in Deutschland auseinandersetzen. Zu nennen sind hier u.a. Ijoma Mangolds autobiographische Darstellung Das deutsche Krokodil (2017), Jackie Thomaes Roman Brüder (2019), Noah Sows „afrodeutscher Heimatkrimi“ Die Schwarze Madonna (2019) sowie Olivia Wenzels Debüt 1000 serpentinen angst (2020). Erst kürzlich erschien der schon länger erwartete Roman Adas Raum (2021) von Sharon Dodua Otoo. Diese Publikationen Schwarzer Autor:innen tragen nicht nur zu vielfältigen Positionierungen in einer wichtigen gesellschaftlichen Auseinandersetzung bei, sie machen auch die „Weiße Normalität“ (Kißling 2020) der deutschsprachigen Literatur und des Literaturbetriebs sichtbar.
Wie Preisverleihungen und Nominierungen zeigen, finden die genannten Werke innerhalb des deutschen Literaturbetriebs aktuell breite Beachtung und Anerkennung: So wurde Otoo 2016 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet, Thomaes Brüder stand 2019 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, und auch Wenzels 1000 serpentinen angst war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Durch die damit verbundene Aufmerksamkeit schärft sich gleichzeitig der Blick für die Bedingungen und die strukturellen Gegebenheiten des Betriebs, wie Olivia Wenzel in einem Gespräch mit Sabine Priess betont hat: „[…] es wäre auch gut mal zu schauen, wer eigentlich in solchen Jurys, wer in welchen Redaktionen sitzt, wer Literaturkritik betreibt. Das sind meistens weiße Menschen, die eher wenig Diskriminierungs-Erfahrung haben. Wenn man nachhaltig im Literatur- oder Kulturbetrieb etwas ändern möchte, müssten nicht nur die Produzent:innen von Kultur diverser sein, sondern auch die Stellen, wo die großen Entscheidungen getroffen werden. Da, wo die Macht sitzt.“
Die Forderung nach Diversität betrifft nicht zuletzt auch die Literaturwissenschaften, die oftmals eine unmarkierte Normalität kulturellen Wissens fortschreiben, welche die damit auf vielfache Weise verbundenen Machtverhältnisse verbirgt. Ihre Offenlegung bedingt Konflikte und Reibungen, die auch die Germanistik institutionell verändern werden, wenn sie bereit ist, ihre Mechanismen der Überlieferung, der Wertung und Kanonisierung zu hinterfragen. In 1000 serpentinen angst konfrontiert die Autorin ihre Leser:innen in einigen Szenen auf durchaus unbehagliche Weise mit den hegemonialen Verhältnissen in deutschen Institutionen und anderen vornehmlich Weißen Räumen. Vor allem aber liefert der Text eine vielstimmige, bruchstückhafte Form für die spannungsgeladene und schmerzhafte Selbstverortung der Schwarzen Ich-Erzählerin zwischen rassistischen Erfahrungen und Privilegien als gebildete und finanziell unabhängige deutsche Frau.
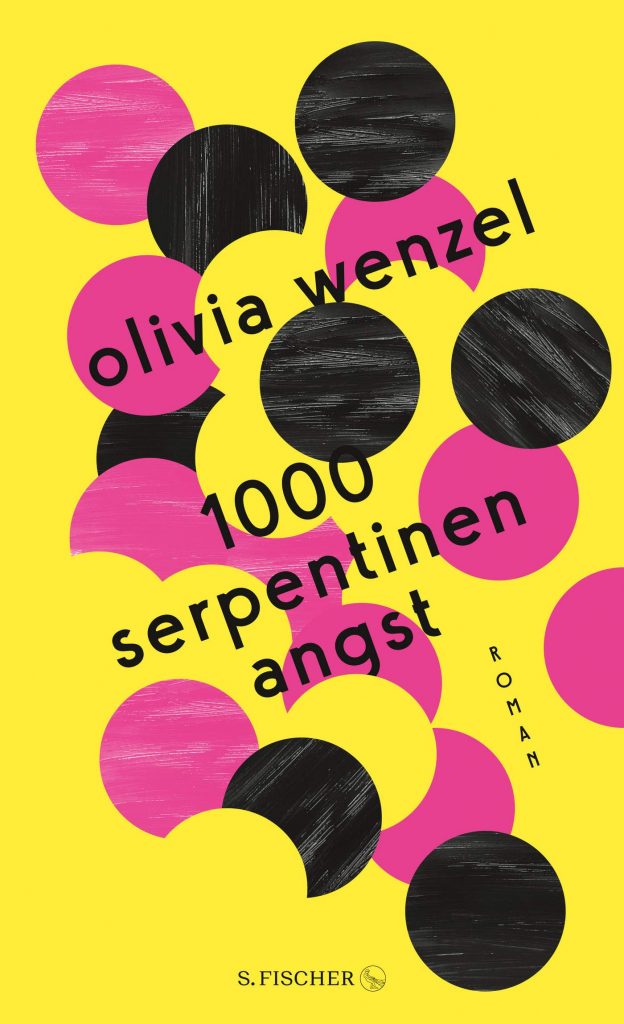
Schon der affektiv aufgeladene Titel zielt auf ein Bild für verschiedene Erfahrungen von Rassismus, die der Text verhandelt; er spielt auf eine riskante, kurvenreiche Wegführung und „die vielen Schlängelbewegungen“ (ebd.) an, welche die Erzählerin auf der Suche nach ihrem Platz im Leben macht, die zugleich als Suche nach einer literarischen Form für all ihre Erlebnisse erscheint. An dieser doppelten Suche nach Zugehörigkeit lässt sie die Leser:innen intensiv teilhaben: Ihre Ängste, aber auch immer wieder erlebte Bedrohungen machen aus den Schlängelbewegungen nur allzu oft „Ausweichbewegungen“ (ebd.). Nur sich selbst weicht die Erzählerin nicht aus, wenn sie im Dialog mit verschiedenen Stimmen prägnante Schlaglichter auf ihr Erwachsenwerden im Osten Deutschlands nach der Wende wirft, auf ihre Kindheit als Tochter einer Weißen Punkerin in der DDR und eines Schwarzen Vaters aus Angola, auf Freundschaften und Reisen sowie auf die enge Beziehung zu ihrem Zwillingsbruder, der sich mit 19 Jahren vor einen Zug geworfen hat.
Zu Beginn des Romans beschwert sich die Ich-Erzählerin: „Alle wollen ständig mit mir über Rassismus sprechen“ (S. 13). Der Selbstverortung steht das Othering als unfreiwillige Rassismusexpertin entgegen. Auf den 1000 erzählten Serpentinen, die sich collagenförmig, mal ausweichend, mal gnadenlos konfrontierend durch den Text winden, bezieht der Roman Stellung in einer affektiv aufgeladenen, politischen Debatte um Identität und multiple Zugehörigkeiten, Rassismus und Kolonialismus, um Klassenfragen und Privilegien, um Migration und Flucht, um das Aufwachsen in der DDR und das „Ossi-Sein“ (S. 164); am Ende zeichnet sich sogar eine zukünftige Ko-Elternschaft mit ihrer ehemaligen Partnerin ab. „BEGREIFST DU DEN GEDANKEN, DASS ALLES, WAS ICH DIR ERZÄHLE, IN EIN EINZIGES LEBEN PASST?“ (S. 341), so die Ich-Erzählerin. Dass dieses „Alles“ auch in einen einzigen Text passt, liegt an der knappen, szenischen Schreibweise, durch die sich verschiedenste Erfahrungen, Reflexionen und Gefühle als Fragmente, als Ausschnitte und Bruchstücke eines Lebens präsentieren. Es gibt kaum linear erzählte Handlung, kurze narrative Passagen wechseln sich mit Gedankensplittern und knappen essayistischen Erzählformen ab.
Als die Protagonistin auf ihrer Selbstsuche in die amerikanischen Südstaaten reist, beobachtet sie einen Mann am Flughafen, der sich „eine Art Plastikgürtel mit einer merkwürdigen Ausbuchtung um die Hüfte“ (S. 25) schnallt und betet. Sprengstoff! Selbstmordattentat! ruft die Ich-Erzählerin ihren Leser:innen in Kursivschrift zu. Die Bänder, die der Mann um seine Arme gewickelt hat, identifiziert die Protagonistin als Kabel oder Drähte. „Excuse me, Sir, do you wanna murder me or is this just a regular prayer?” (S. 26), fragt die Ich-Erzählerin – jedoch nur ihre Leser:innen. Statt die Konfrontation mit der betenden Figur zu suchen, wendet sich die Protagonistin an einen Polizisten, doch der vermeintliche Terrorist wartet längst gelassen auf seinen Flug. „Welcome on board! How are you today?“, dröhnt es kurz darauf aus einem Lautsprecher im Flugzeug: „Voller Selbstekel, danke“ (ebd.), antwortet die Protagonistin.
In dieser Sequenz wird nicht nur die Angst vor einem imaginierten Terroranschlag verhandelt, sondern auch die Scham, jemanden aufgrund seiner äußeren Erscheinungsweise pauschal verdächtigt zu haben. Mithin deckt das Selbstgespräch die eigenen rassistischen Vorurteile auf, um sie zu reflektieren und zu kritisieren. Damit ebnet die Autorin den Weg zur kritischen Auseinandersetzung der Leser:innen mit sich selbst. Vor allem aber macht Wenzel deutlich: Auch wer selbst von Rassismus betroffen ist, kann rassistische Denkmuster und stereotypische Zuschreibungen verinnerlicht haben.
So bietet Olivia Wenzels Roman 1000 serpentinen angst einen produktiven Ansatz, um sich mit strukturellem Rassismus und multiplen, widersprüchlichen Zugehörigkeiten auseinanderzusetzen. Auch die Anerkennung von Diversität im deutschen Literaturbetrieb steht weiter zur Diskussion. So haben zahlreiche Unterzeichner:innen in einem offenen Brief kritisiert, dass trotz vieler Möglichkeiten keine Schwarzen Autor:innen oder Autor:innen of Color für den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurden. Doch auch die Germanistik ist herausgefordert, sich mit Rassismus und mit der Literatur Schwarzer Autor:innen zu befassen und intersektionale Konzepte zu entwickeln, um das allzu selbstverständliche Weißsein ihrer Gegenstände und ihrer Akteur:innen zu hinterfragen.
Literatur:
Wenzel, Olivia: 1000 serpentinen angst. Frankfurt am Main 2020.
Kißling, Magdalena: Weiße Normalität. Perspektiven einer postkolonialen Literaturdidaktik. Bielefeld 2020.




